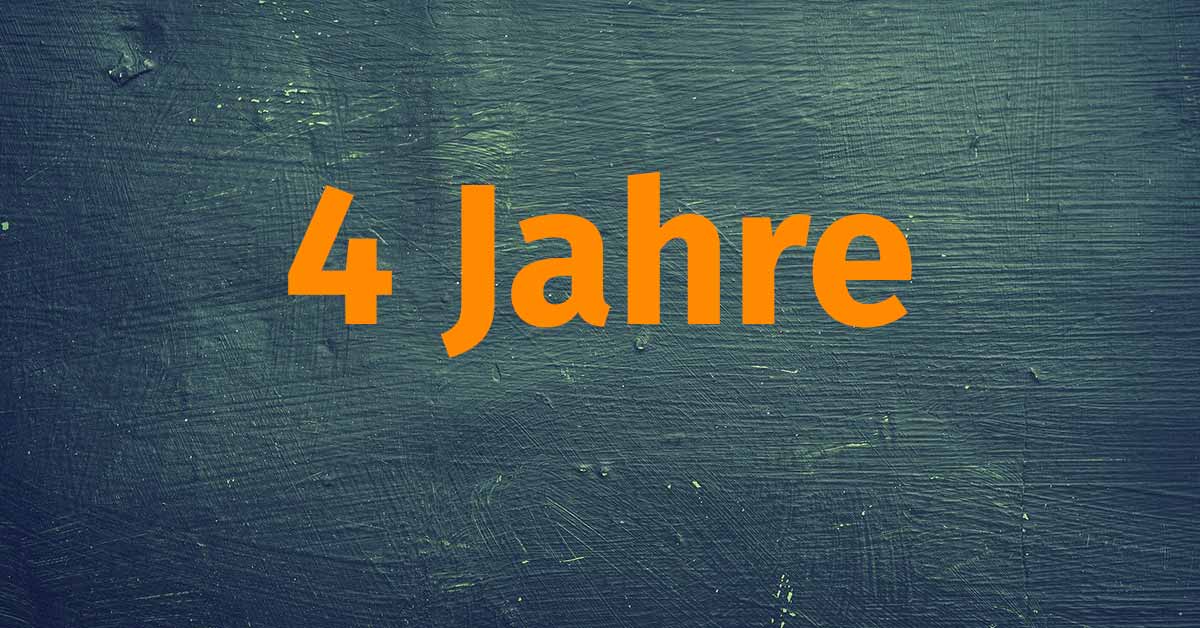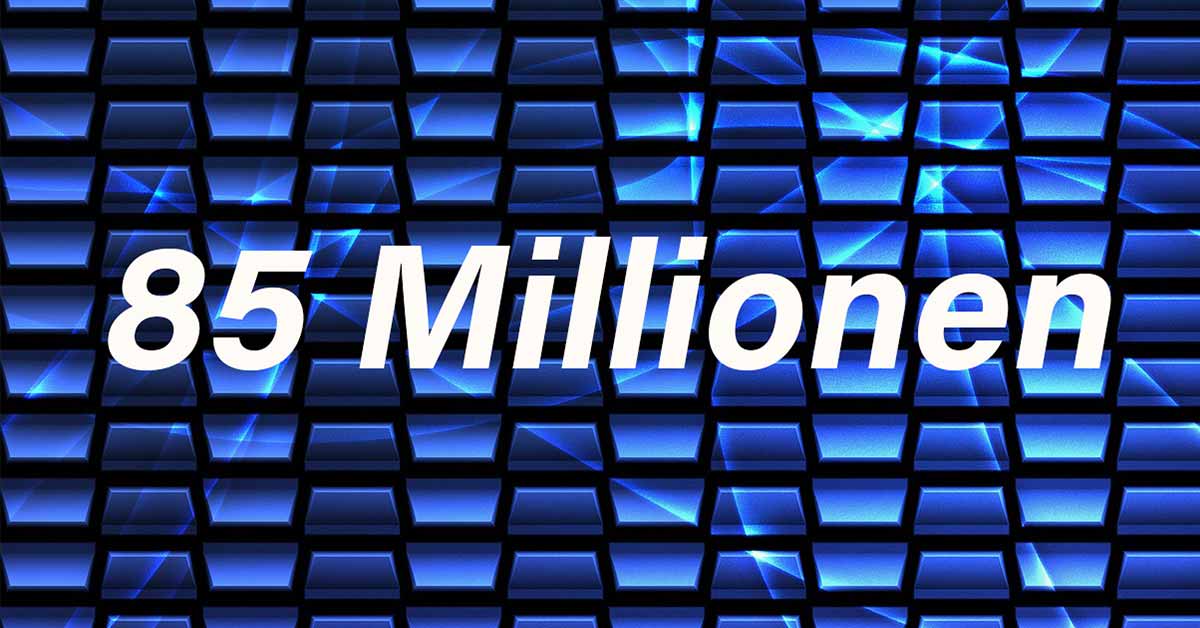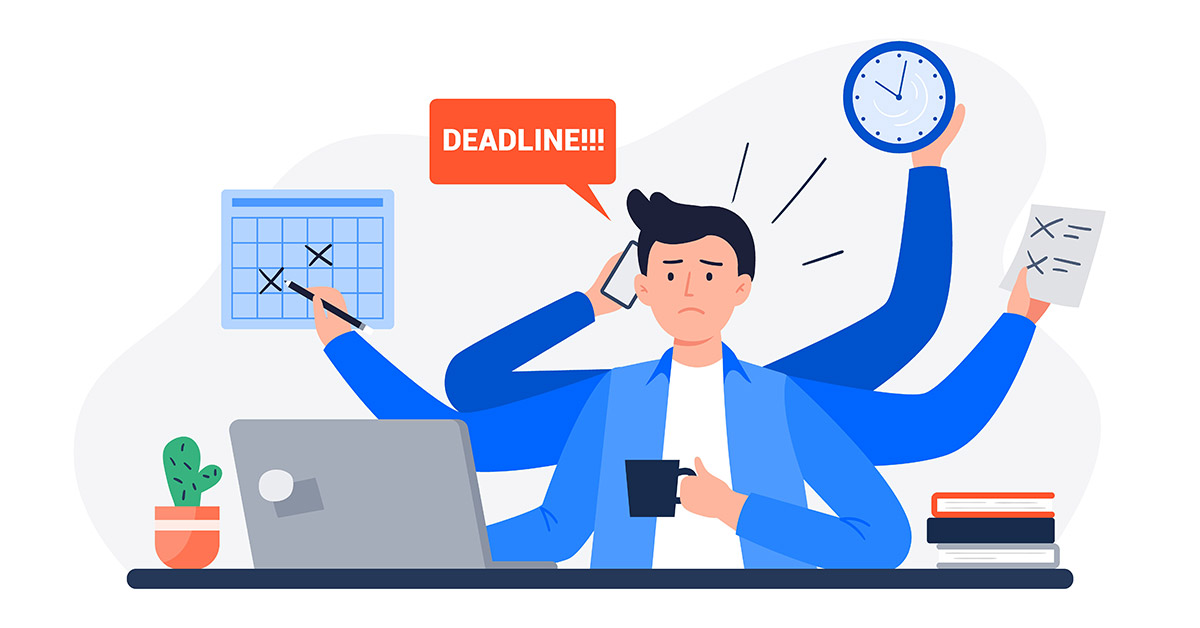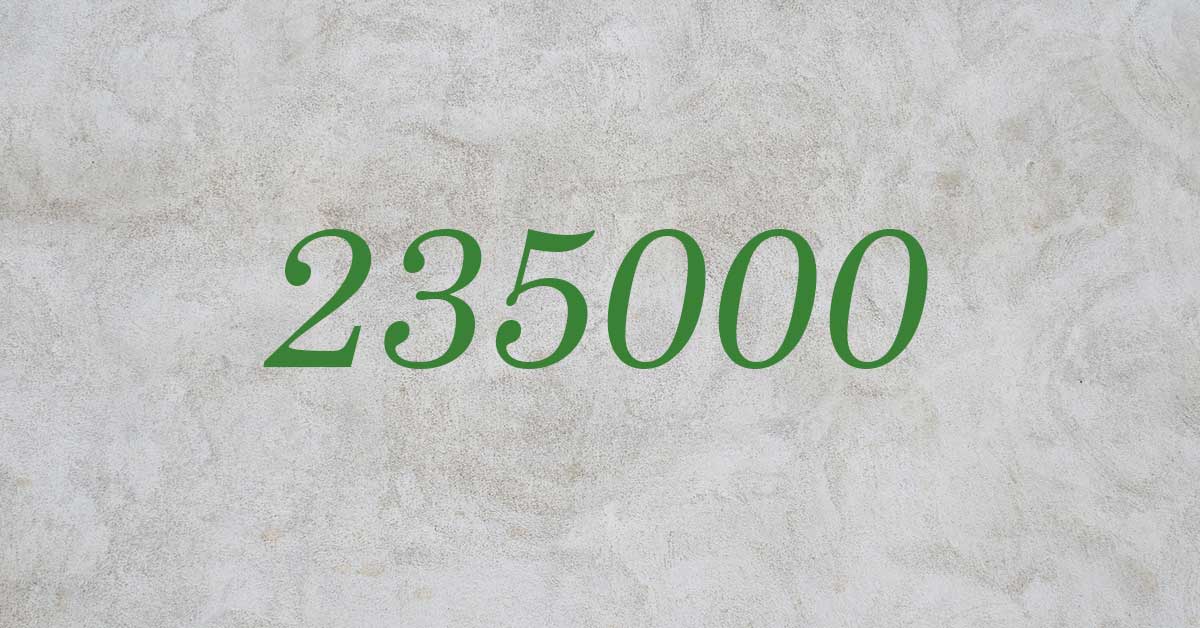Wenn die Entscheidung für einen Immobilienverkauf gefallen ist, steht als einer der ersten Schritte die Preisermittlung an. Schließlich möchte man einen guten Preis erzielen, der zudem der aktuellen Marktlage entspricht. Was macht also der moderne, netzaffine Eigentümer? Er sucht im Internet nach einer schnellen Lösung, um die Immobilie bewerten zu lassen. Nicht unbedingt die beste Entscheidung.
Denn mit einer Online-Werteinschätzung gibt es zwar nach wenigen Klicks ein Ergebnis, an dem man sich orientieren kann. Aber eins, auf das man nicht vertrauen sollte. Die genaue Bewertung einer Immobilie ist aufwendig, viele Faktoren müssen berücksichtigt und alle Unterlagen hinzugezogen werden. Nicht nur Lage, Ausstattung und Zustand spielen eine Rolle, wenn es darum geht, den Preis eines Hauses oder einer Wohnung zu ermitteln.
Persönlich vor Ort und nicht anonym im Netz
Für eine professionelle Wertermittlung, die alle Punkte berücksichtigt und die vor allem vor Ort durchgeführt wird, sollte man sich an einen Makler oder Sachverständigen wenden. Er ist der richtige Ansprechpartner, denn mit seiner Kenntnis der regionalen Lage und Preisdynamik wird er den Preis für die zu verkaufende Immobilie ansetzen, der sie auch wirklich wert ist. Zudem ist er eine neutrale Person, die einen objektiven, frischen Blick auf die Immobilie hat. Er wird sie auf jeden Fall direkt vor Ort in Augenschein nehmen, um den Verkehrswert (oder auch Marktwert) fachgerecht ermitteln zu können. Faktoren, die darauf einen Einfluss haben, können sein: wo liegt die Immobilie, welche Ausstattung gibt es, sind Renovierungen oder Schönheitsreparaturen notwendig?
Mängel erkennen und nennen
Ebenfalls wichtig sind Mängel, die zunächst aufgespürt und schließlich bei der Bewertung berücksichtigt werden müssen. Auch im Exposé müssen sie genannt werden. Bauliche Besonderheiten, wie etwa eine ungewöhnliche Raumaufteilung, haben auch Einfluss auf den Preis. Die Anordnung der Räume kann schließlich sehr gefragt oder nur für einen kleinen Kreis interessant sein. Nachdem der Makler oder Sachverständige die Immobilie „äußerlich“ geprüft hat, geht es an die Unterlagen.
Was die Unterlagen verraten
Im Grundbuchauszug finden sich Informationen dazu, ob es Ansprüche von Dritten gibt, das heißt zum Beispiel Nießbrauch-, Vorkaufs- oder Wohnrechte. Notwendig für eine Ermittlung sind zudem Nachweise über Modernisierungen bei Dämmung, Dach oder Heizung. Handelt es sich bei der Verkaufsimmobilie um eine Eigentumswohnung, kommen neben Aufteilungsplan, Teilungserklärung und Nebenkostenabrechnung auch die letzten drei Protokolle der Eigentümerversammlung hinzu. Ist die Kaufimmobilie vermietet, werden natürlich auch die dazu gehörigen Unterlagen geprüft.
Lieber den Profi machen lassen
Ob Sachwertverfahren – das bei Häusern ohne Vergleichsobjekt zur Preisermittlung genutzt wird, Vergleichswertverfahren – das man bei unbebauten Grundstücken und Eigentumswohnungen einsetzt, oder Ertragswertverfahren bei der Wertermittlung für Mehrfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien – eine professionelle Immobilienbewertung ist aufwendig und anspruchsvoll. Verlassen Sie sich also lieber auf einen Profi und beauftragen einen Makler oder Sachverständigen.
Sie wollen wissen, was Ihre Immobilie wirklich wert ist? Fragen Sie uns – wir beraten Sie gern.
Hinweise
In diesem Text wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.
Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.
Foto: © Sentavio/Depositphotos.com